Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung, kurz ADHS, ist eine der am häufigsten beschriebenen neurobiologischen Entwicklungsstörungen. Lange Zeit wurde ADHS fast ausschließlich mit unruhigen, zappeligen Kindern – meist Jungen – in Verbindung gebracht. Heute wissen wir: ADHS ist komplexer, vielfältiger und betrifft Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es handelt sich weder um eine „Modediagnose“ noch um eine reine Kinderkrankheit, sondern um ein Spektrum von Ausprägungen, das lebenslang bestehen kann.
Was ist ADHS?
ADHS ist eine Störung der Selbstregulation. Betroffene haben Schwierigkeiten, Aufmerksamkeit, Impulse und Aktivitätsniveau flexibel zu steuern. Im Gehirn spielen dabei Botenstoffe wie Dopamin und Noradrenalin eine entscheidende Rolle. Diese Neurotransmitter sind wichtig für Motivation, Belohnung und die Fähigkeit, Aufgaben gezielt zu bearbeiten. Bei ADHS läuft dieser Signalfluss verändert ab: Reize werden entweder zu stark oder zu schwach gefiltert, wodurch es schwerfällt, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden.
ADHS oder ADS – wo liegt der Unterschied?
In der Alltagssprache taucht oft auch der Begriff ADS (Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom) auf. Streng genommen handelt es sich nicht um eine eigenständige Diagnose, sondern um eine Bezeichnung für den vorwiegend unaufmerksamen Typ von ADHS.
- ADHS (mit H) beschreibt die Störung mit Hyperaktivität und Impulsivität – also dem klassischen „Zappelphilipp“-Bild.
- ADS (ohne H) meint eine Form, bei der Unaufmerksamkeit, Vergesslichkeit, Verträumtheit und langsames Arbeiten im Vordergrund stehen, ohne dass die Betroffenen besonders zappelig oder laut sind.
In internationalen Diagnosekriterien (DSM-5, ICD-11) wird ADS nicht mehr separat verwendet, sondern als Subtyp von ADHS geführt. Umgangssprachlich ist der Begriff jedoch noch weit verbreitet, besonders wenn es um Menschen geht, die eher still und verträumt wirken.
Anzeichen und Formen
Die Symptome können sehr unterschiedlich sein. Fachlich werden drei Haupttypen unterschieden:
- Vorwiegend unaufmerksamer Typ: eher verträumt, vergesslich, chaotisch, langsamer Start bei Aufgaben.
- Vorwiegend hyperaktiv-impulsiver Typ: motorische Unruhe, starke Impulsivität, schnelles Handeln ohne Nachdenken.
- Kombinierter Typ: Mischform beider Varianten.
Gerade bei Mädchen und Frauen zeigt sich ADHS oft weniger durch offensichtliche Hyperaktivität, sondern eher durch innere Unruhe, emotionale Intensität, Ängstlichkeit oder Rückzug. Deshalb wird ADHS bei Frauen häufig erst spät oder gar nicht erkannt – ein Umstand, der sich aus der früher stark männlich geprägten Forschung ableitet („Zappelphilipp“-Stereotyp).
Häufigkeit von ADHS
Weltweit sind etwa 5–7 % der Kinder von ADHS betroffen, bei Erwachsenen geht man von rund 2–5 % aus. In vielen Fällen bleibt die Diagnose jedoch unerkannt oder wird erst spät gestellt, da die Symptome sehr variabel sind und leicht mit anderen Schwierigkeiten wie Depressionen, Angststörungen oder Lernproblemen verwechselt werden können.
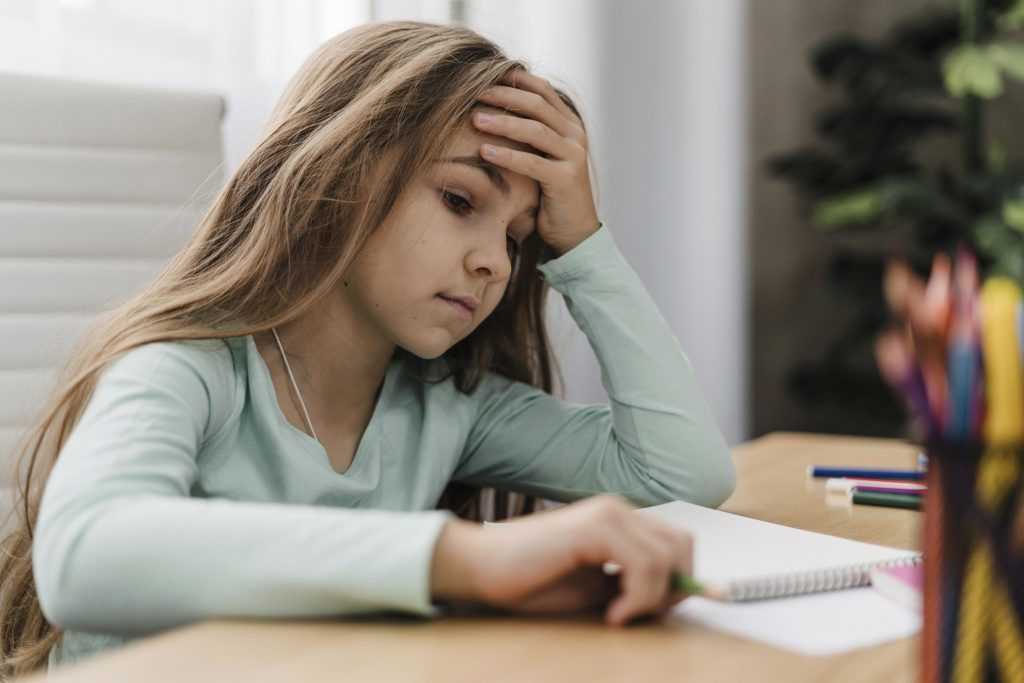
ADHS Diagnose
Die Diagnose erfolgt durch Fachärzt:innen oder Psychotherapeut:innen und stützt sich auf Gespräche, Beobachtungen, standardisierte Fragebögen und oft auch Fremdanamnesen (z. B. von Eltern oder Partner:innen). Wichtig ist, andere Ursachen wie Schlafstörungen, Schilddrüsenerkrankungen oder traumatische Erfahrungen auszuschließen.
Behandlungsmöglichkeiten
ADHS ist nicht heilbar, aber sehr gut behandel- und managbar. Bewährte Ansätze sind:
- Medikamentöse Therapie: z. B. Stimulanzien wie Methylphenidat oder Amphetaminpräparate, die den Dopaminstoffwechsel regulieren.
- Gesprächstherapie und Coaching: zur Stärkung von Selbstwert, Struktur und emotionaler Regulation.
- Ganzheitliche Methoden: Bewegung, Achtsamkeitstraining, ausgewogene Ernährung, Schlafhygiene und Entspannungstechniken können Symptome abmildern.
- Familien- und Umfeldarbeit: damit auch Angehörige verstehen, wie ADHS wirkt und wie Unterstützung aussehen kann.

Chancen und Stärken
Auch wenn ADHS große Einschränkungen im Alltag mit sich bringen kann – von Konzentrationsproblemen über berufliche Hürden bis hin zu sozialem Stress – gibt es viele positive Eigenschaften:
- Kreativität und originelles Denken
- Spontaneität und Begeisterungsfähigkeit
- hohe Sensibilität und Empathie
- Energie und Resilienz in interessanten Aufgaben („Hyperfokus“)
Diese Stärken können gezielt gefördert und als Ressource genutzt werden.

ADHS ist eine ernstzunehmende, neurobiologische Störung – kein Trend und kein Etikett für lebhafte Kinder. Sie zeigt sich auf einem Spektrum, betrifft Männer wie Frauen, Kinder wie Erwachsene, und erfordert eine individuelle Herangehensweise. Wer ADHS hat, muss lernen, mit den eigenen Besonderheiten zu leben – und kann dabei von professioneller Begleitung, Medikamenten, Alltagshilfen und einem verständnisvollen Umfeld profitieren.
ADHS bringt Herausforderungen, aber auch Chancen. Mit der richtigen Unterstützung können Betroffene ihre Stärken entfalten und ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben führen.
Ich wünsche dir, bei jeder gesundheitlichen Herausforderung die passende Hilfe!
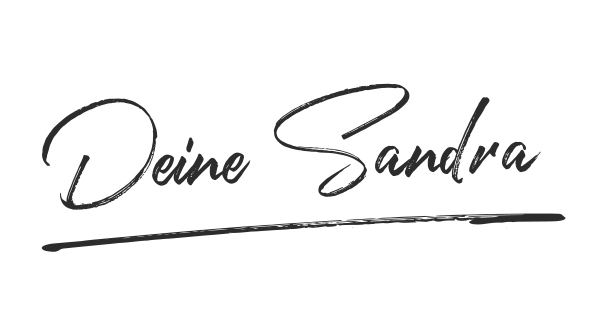

Sandra Strixner
ist eine Genussweltenbummlerin die gerne neue Länder und Kulturen entdeckt. Rezepte auf Pflanzenbasis zu entwickeln lässt ihr Herz höher schlagen. Sie ist ein Green-Networker und beschäftigt sich mit Persönlichkeitsentwicklung, Ernährungslehre und Tierschutz. Als geprüfte Fachberaterin für holistische Gesundheit darf sie Menschen dabei begleiten sich selbst zu heilen.
Quellen
- American Psychiatric Association (2022): Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5-TR).
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2018): Attention deficit hyperactivity disorder: diagnosis and management.
- Thome, J. & Rösler, M. (2016): ADHS im Erwachsenenalter – Leitlinien und Forschung.
- World Health Organization (2021): International Classification of Diseases, 11th Revision (ICD-11).
Photocredits Titelbild: freepik.com

